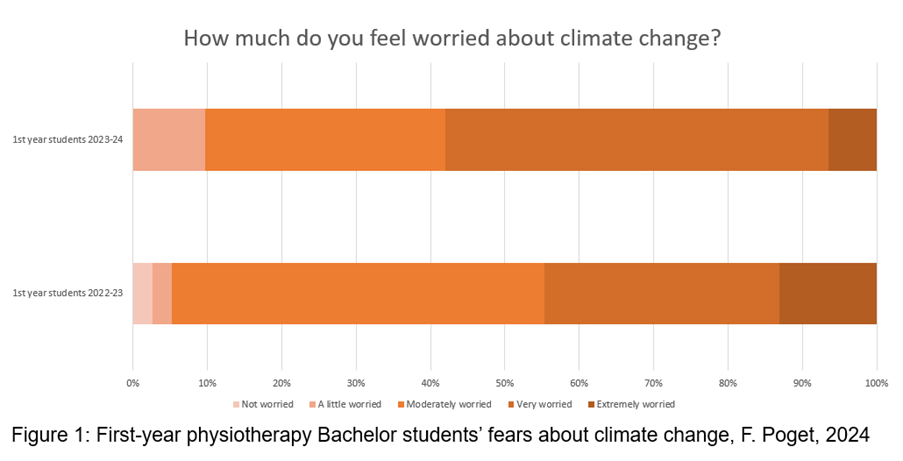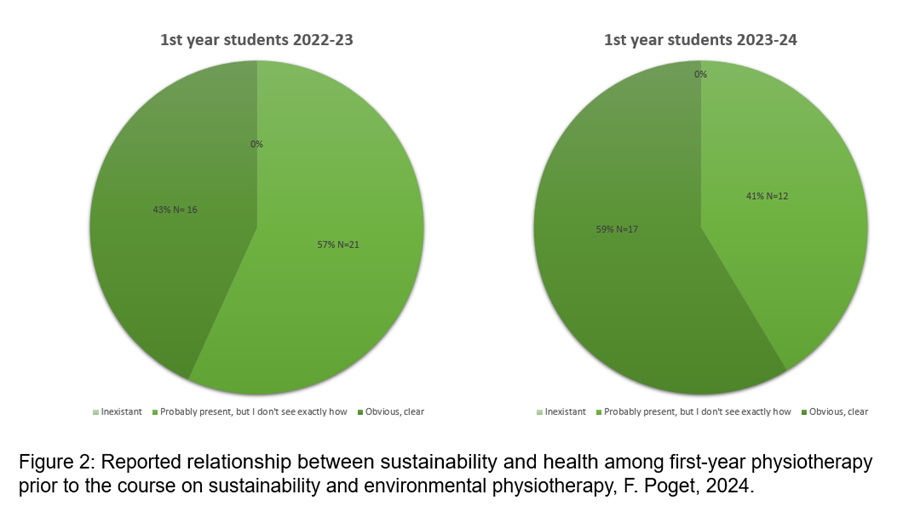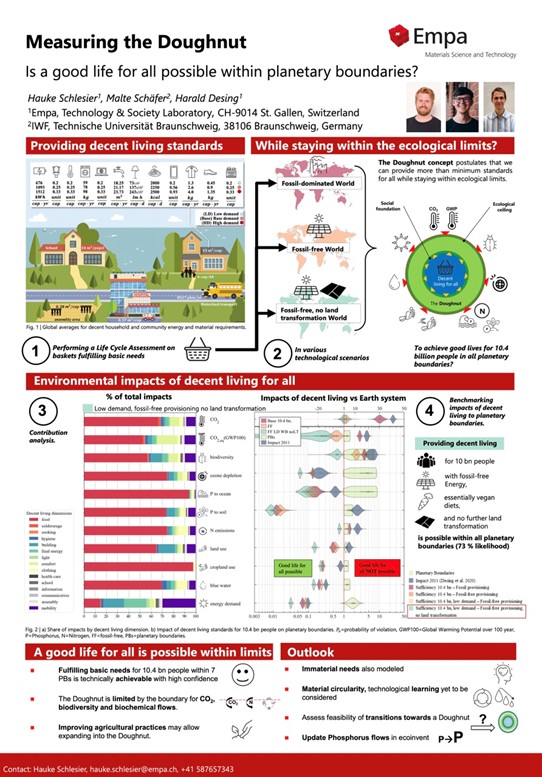Mirjam Arn, Arbeitsgruppe Planetary Health, VSAO.
Ziel: Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Mitarbeitenden von Gesundheitsinstitutionen zu gesundheitlichen Folgen des Klimawandels und präventiven Ansätzen zur Förderung eines gesunden und umweltfreundlichen Lebensstils.
Methode: Verteilen von Postern und Flyern mit Informationen zu gesundheitlichen Folgen des Klimawandels und präventiven Ansätzen zur Förderung eines gesunden und umweltfreundlichen Lebensstils. Zielpublikum sind Patient:innen in Wartebereichen von Praxen und Spitälern, sowie die dort berufstätigen Ärzt:innen und medizinischen Fachpersonen. Auf Plakat und Flyer findet sich der Verweis auf eine Webseite mit genaueren Informationen zum Thema.
Hindernisse bei der Umsetzung: Die Dozierende die Teilgenommen haben, waren schon interessiert im Thema. Es ist die Frage, wie wir andere Dozierenden für diese 2S4F begeistern können. Teilweise werden auch Bedenken geäussert, ob genug zeitliche Ressourcen in den Vorlesungen vorhanden sind, um das Thema Nachhaltige Entwicklung spezifischer und mit Praxisbeispiele einzubringen.
Umsetzungsphasen: 08/2023 – 02/2024 Grundidee Poster, Ausarbeitung Inhalt und Design erster Entwürfe
02/2024 – 04/2024 Finalisierung Design und Inhalt Poster
04/2024 – 07/2024 Einholen Einverständis und Unterstützung mittragender Institutionen (FMH, AefU, swimsa)
ab 07/2024 Druck und Herausgabe der Plakate und Flyer
Ergebnisse: 
Andere am Projekt beteiligte Personen:
Nora Höger, Manuel Cina, Antonio Tuminello, Vasilica Matei, Samuel Beck. VSAO